
Tempo 30 bremst den öffentlichen Verkehr aus und mindert seine Attraktivität wegen längerer Reisezeiten: Diese Befürchtung äussern Branchenvertreter seit Wochen. Doch stimmt sie auch? Die Stadt Zürich legt nun konkrete Daten von Vorher-Nachher-Messungen vor.
von Stefan Ehrbar
17. August 2021
Sie möchten werbefrei lesen? Jetzt kostenlos testen!
Die Signalisierung von Tempo 30 statt Tempo 50 ist eines der ganz heissen Eisen der Verkehrspolitik. Nachdem Städte wie Zürich und Winterthur bekanntgegeben haben, künftig flächendeckend auf die tiefere Geschwindigkeit zu setzen, werden Befürchtungen laut, dass dies dem öffentlichen Verkehr schaden könne. «Es ist klar, dass der öffentliche Verkehr mit generell Tempo 30 auf den Hauptachsen der Städte unattraktiver wird», sagte Ueli Stückelberger, der Direktor des Verband öffentlicher Verkehr (VöV), zu CH Media. Werde der ÖV langsamer, nutzten ihn die Leute weniger. Mitte-Nationalrat und Verkehrspolitiker Martin Candinas sagte: «Leider machen sich die rot-grün regierten Städte daran, den öffentlichen Verkehr zu Gunsten der Mofas oder Velos zu schwächen» (zum Mobimag-Interview mit Martin Candinas).
Sie möchten werbefrei lesen? Jetzt kostenlos testen!
Tatsächlich rechnen auch die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) mit Mehrkosten, sollte Tempo 30 umgesetzt werden. Da der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) diese nicht bezahlen möchte, würde das mit einem Angebotsabbau einhergehen – wenn nicht die Stadt einspringt. Die VBZ dachten bereits über die Einstellung einer Buslinie nach (Mobimag berichtete). Denn wenn Busse und Trams langsamer fahren können, brauchen die ÖV-Unternehmen mehr Fahrpersonal und zusätzliche Fahrzeuge, um die selben Strecken im selben Takt bedienen zu können.
Andererseits argumentieren städtische Politiker, dass der Lärmschutz eine gesetzliche Aufgabe und Tempo 30 ein effektives Mittel dafür ist. Zudem würden auch Mehrausgaben, die dem ÖV etwa wegen Staus entstehen, bezahlt – und Tempo 30 verflüssige den Verkehr. Nur in seltenen Fällen komme es zu einer Kapazitätsminderung, sagte der SP-Kantonsrat Felix Hoesch im Mobimag-Interview.
Doch welche Auswirkungen hat Tempo 30 ganz konkret auf den ÖV? Die Stadt Zürich hat diese Antwort vor einiger Zeit gegeben, zumindest mit Blick auf den Lärmschutz. Das Fazit ist eindeutig: Tempo 30 wirkt. Die Lärmbelastung sinkt damit deutlich. Messungen, welche die Stadt Zürich in Auftrag gab, zeigten eine Lärmreduktion in der Nacht zwischen -1,6 Dezibel und -2,6 Dezibel auf Strecken, auf denen Tempo 30 eingeführt wurde. Bereits ab einem Dezibel sind Lärmreduktionen wahrnehmbar.
Sie möchten werbefrei lesen? Jetzt kostenlos testen!
Nun gibt die Stadt Zürich auch eine Antwort auf die Frage, wie viel Zeit der öffentliche Verkehr wegen Tempo 30 verliert. Es ist nicht wenig.
Gemessen wurde die Zeit, die der Bus der Linie 40 zu verschiedenen Tageszeiten verliert, weil auf der Seebacherstrasse im Juli 2019 Tempo 30 eingeführt wurde.
Die Vorher-Messungen fanden im April und Mai 2017 statt, die Nachher-Messungen im September 2020. In der Hauptverkehrszeit am Morgen und am Abend (zwischen 7 und 8 Uhr und zwischen 17 und 18 Uhr) verlor der Bus jeweils 25 Sekunden wegen Tempo 30.
Dabei handelt es sich um eine Strecke mit der Länge von ca. 1,9 Kilometern. Laut Fahrplan benötigt der Bus derzeit inklusive der Zwischenhalte vier Minuten für die Strecke, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 28,5 Kilometern pro Stunde entspricht. Bei einer Verlustzeit von 25 Sekunden war der Bus demnach zuvor mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 31,8 Kilometern pro Stunde unterwegs. In der Spitzenstunde entspricht die prognostizierte Verlustzeit wegen Tempo 30 einer Fahrzeitverlängerung von etwa 15 Prozent. Dabei handelt es sich nicht um präzise Werte, sondern Annäherungen – und diese Rechnung gilt nur für die Stosszeiten. Tagsüber und abends ist die Verlustzeit deutlich tiefer.
Weitere Messungen fanden auf einem 1,8 Kilometer langen Abschnitt auf der Strecke der Buslinie 46 in Zürich-Wipkingen statt, welcher zwischen 2017 und 2019 umsignalisiert wurde.
[…]
Der ganze Artikel ist exklusiv für Abonnenten zugänglich.
Mehr Informationen zu unseren Abos ab 1.50 Franken erhalten Sie hier.
Jetzt kostenlos eine Woche lang testen?
Zugang mit nur einem Klick!
Voraussetzung ist eine gültige Kreditkarte oder ein Paypal-Account. Innerhalb der ersten 7 Tage findet keine Belastung statt. Sie können Ihr Probeabo jederzeit mit einem Klick beenden. Ansonsten lesen Sie nach einer Woche für 7.90 Franken pro Monat weiter. Sie können jederzeit und fristlos kündigen.
Sie haben bereits einen Zugang?
Login


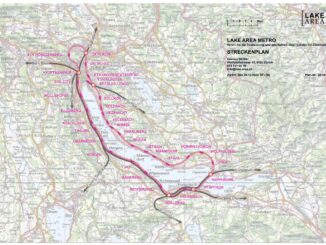
Schreiben Sie einen Kommentar